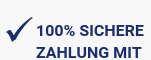Gasinstallation
Eine Gasanlage ist auf dem Boot ein heikles Thema den Flüssiggas ist hochentzündlich und in Verbindung mit Sauerstoff zudem noch hoch explosiv. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig sich bei einem Fachmann zu informieren. Und sich auch ausschließlich nur durch einen Fachmann eine Gasanlage installieren lassen. Zum, Glück ist die Zahl der schweren Unfällen mit Gasanlagen auf dem Boot sehr gering. Das liegt unteranderem auch an den strengen Normen und Regelungen für Gasanlagen an Bord sowie an den gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen. In der Europäischen Union ist die Installation von Gasanlagen auf dem Boot durch die Regel der Norm DIN EN ISO 10239 festgelegt. Darüber hinaus muss die Gasanlage alle zwei Jahre von einem zertifizierten Sachverständigen in der G608 Prüfung Kontrolliert und abgenommen werden. Unabhängig von dieser Vorschrift ist es Teil guter Seemannschaft, sich selber von der Sicherheit der Anlage an Bord zu überzeugen. Die gesetzliche Vorschrift einer Neuinstallation ist sehr komplex und muss unbedingt eingehalten werden. Hier nur einen kleinen Einblick auf was geachtet werden muss und warum es so wichtig ist sich einen Fachmann an die Seite zu holen: Neuinstallationen einer Gasanlage dürfen nur noch im 30 mbar ausgeführt werden. Mischanlagen mit unterschiedlichem Drück sind verboten. Rohrleitungen müssen aus Kupfer oder Edelstahl bestehen am besten mit DVGW Prüfstempel. Bei der Verwendung von VA Rohren müssen auch sämtliche Verbinder und Absperrventile aus VA sein. Rohrleitungen aus Kupfer müssen alle 50cm mit gummiarmierten Rohrschellen befestigt werden, Edelstahlrohre alle 100cm. Die Gasrohre dürfen nicht gelötet oder verpresst werden. Sie sehen es gib sehr strenge Regeln die wir hier nicht alle aufführen können und werden da dies keine Anleitung werden soll. Kontaktieren Sie uns gerne wenn Sie sich für eine Gasanlage interessieren, wir haben geschulte Mitarbeiter mit Zertifikat zur Abnahme der G608 Prüfung.
In unserem Shop finden sie alles für eine Fachmännische Gasinstallation, von Flaschenventile, Schneidringverschraubungen, Gasschlauchleitungen zu den Gaswarnsystemen. Ein Gaswarnsystem ist eine sehr sinnvolle Angelegenheit und kann im Ernstfall Leben retten. Darum ist es Ratsam sich darüber im Vorfeld zu Informieren denn auch da gibt es kleine aber feine Unterschiede. Es gibt Gaswarner die speziell Flüssiggase wie Propan oder Butan erkennen und einen Alarm auslösen bevor wir Menschen es überhaupt erst riechen können. Die richtige Anbringung spielt zudem auch eine wichtige Rolle, so werden in Häusern mit einer Gasheizung die Gaswarner oberhalb der möglichen Austrittsquelle angebracht den Erdgase wie z.B. Ethan oder Methan sind leichter als Luft und steigen nach oben . Flüssiggase wie Propan oder Butan hingegen sind schwerer als Luft und sollten deswegen auch unterhalb der Austrittsquelle angebracht werden. Achten sie darauf, dass jeweils eine Steckdose in der Nähe ist, da ein Gasmelder mehr Strom verbraucht als ein Rauchmelder und eine Batterieleistung nicht ausreichend ist. Denn die meisten Gaswarner funktionieren über die Heiß-Draht-Methode. Demnach wird ein Draht im Inneren der Melder über Strom kontinuierlich zum Glühen gebracht. Sobald ein Gas in die Messkammer einströmt, entzündet sich der Draht und es kommt zu einer kleinen Verbrennung. Diese Verbrennung führt zu einem Temperatur- und Druckanstieg in der Messkammer. Die Elektronik nimmt die Daten der veränderten Spannung auf und löst einen Alarm aus.